Juraj Baláž: Gestern, heute…
Berlin 2. August 2022
Wahrlich viel Staub hat die realsozialistische Elite, die Nomenklatura, aufgewirbelt als sie offenbarte, dass die gesellschaftliche Krise des realen Sozialismus nur durch Abschaffung des Systems selbst zu bewältigen war. Aber damit war Gestern noch nicht vorbei. Gemäß der ihr eingeimpften Unfehlbarkeit fuhr sie fort Halbwahrheiten zu streuen um ihr eigenes Versagen zu kaschieren. So hat sie über Nacht herausgefunden, dass der Marxismus ein Irrglaube war und das ganze System von Beginn an dem Untergang entgegen lief. Zum Kernstück der Erzählung dieser Transformation-Elite gehörte jedoch die mythisch anmutende Prosa, dass sie im Alleingang dem „unnatürlichen System“ friedlich den Gar ausgemacht hat und folglich sie allein gab den Menschen nicht nur ihre Freiheit zurück, sonder darüber hinaus öffnete sie jene Horizonte, die für die Gestaltung des individuellen Glückes unabkömmlich waren. Ins kalte Wasser der freien Marktwirtschaft, alle!
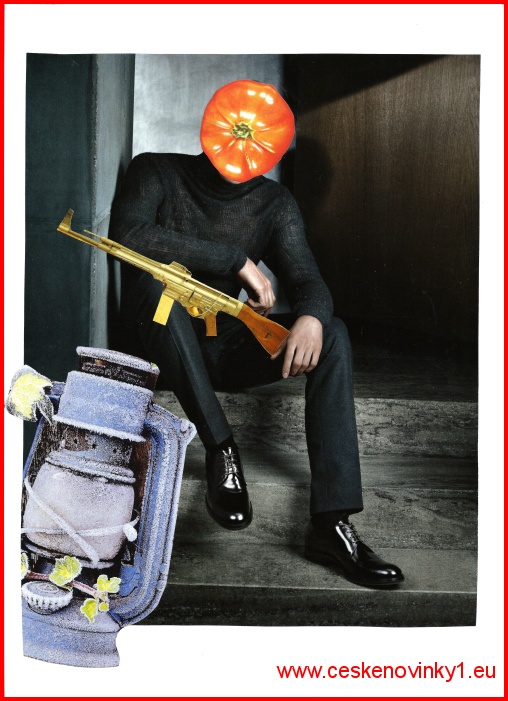
Vielleicht zu der größten Überraschung der letzte Jahrzehnte gehört das Engagement der ehemaligen und neuen linken Eliten im Projekt der „offenen Gesellschaft“. Die Idee der „offenen Gesellschaft“ bekam ihre populäre Deutung bei Karl Popper (Karl Raimund Popper, Offene Gesellschaft und ihre Feinde. Band 1, Der Zauber Platons, Ges. Werke 5, Tübingen, 2003, 524 S.; Bd. 2, Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen, Stuttgart, 1991, 835 S.). Es war gewiss unschwer Poppers Gedanken gesellschaftspolitisch zu instrumentalisieren, denn der Meister selbst hat seine Philosophie den eigenen politischen Überzeugungen unterstellt. Bei George Soros (George Soros, Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr, Frankfurt/Main, 2000, 300 S.), dem Promoter der Idee „offener Gesellschaft“, hat diese allerdings eine folgenschwere Metamorphose durchgemacht. Sie gerne übersehen, obwohl in der politischen Ökonomie der post-popperschen „offenen Gesellschaft“ die freie Konkurrenz, die herkömmliche freie Marktwirtschaft fortan abgeschafft und in eine „reflexive Wirtschaft“ umgebaut werden soll. Erst wenn sie dem wahren Kapitalismus Platz macht kann die Wirtschaft voll der Verpflichtung nachkommen, die Bedingungen der Vermögenssicherung d.i. die gesicherte und zugleich freie Bewegung des Kapitals zu gewährleisten. Im Klartext, es geht um Realisierung eines planbaren Renditenzuwachses für freie Investitionen auf dem Kapitalmarkt bei einer gleichzeitigen öffentlichen Abfederung von negativen Folgen der Geldspekulationen. Dabei wird für diese Struktur die gegenseitige Ergänzung zwischen spendenden Oligarchen (Misanthropen) und politischen Linken (Kümmerer) stillschweigend vorausgesetzt.
Vor uns liegt eine Neuauflage des Trotzkismus der globalen Eliten, mit immer länger währenden Krisen und kurzen Ruhephasen. Ein eigensinniges Projekt, auf das bereits begründete Hoffnungen realisiert zu werden gesetzt sind. Im sog. „großen Umbruch“ (Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19: der große Umbruch, Genf, 2021, 335 S.) geht Klaus Schwab und Thierry Malleret um die globale Neuausrichtung der Welt nach der globalen Covid-Krise. Das „blaue Buch“ ist leicht und verständlich geschrieben, Tendenzen werden beschrieben und Präferenzen gesetzt. So sagt eine der markantesten Stellen im Buch folgendes aus: „Im Gegensatz zu früheren Pandemien ist es alles andere als gesichert, dass die Covid-19 Krise zu Gunsten der Arbeit und zu lasten des Kapitals kippen wird. Aus politischen und sozialen Gründen wäre sie dazu imstande, aber durch die Technologie ändern sich die Kräfteverhältnisse“(S. 45). Mit Technologie ist vor allem die Robotisierung gemeint (Industrie 4.0), welche Arbeit ersetzt. Nicht zu unterschätzen jedoch sind die Hinweise auf Contact Tracing sowie Trackintechnologien, die im Zuge der Pandemiebekämpfung bereits erfolgreich eingesetzt worden sind. Die herausragende Stellung von Technologie im modernen kapitalistischen System ist zweifach verankert. Einerseits sticht Technologie als ein Stabilisator (Subjektivierung durch Normalisierung) des Systems hervor, andererseits sichert sie die neokoloniale Dominanz, genannt Globalisierung, desselben ab.
Schon seit einiger Zeit drängt die globalisierende Elite auf die Realisierung einer sozialen Struktur die drei Glieder kennt – Kapital, Wissen und Dienen. Die Ausnahmestellung der lebenssicherden Eliten, vor allem gegenüber der Dienenden, soll repressiv, weil undemokratisch, abgesichert werden. Gerade globale nichtgewähten auserwählten Vertreter dieser lebenssichernden Eliten sollen mittels modernen und komplexen Macht- und Einflussstrukturen den Vertreter von ökonomischen, technischen, wissenschaftlichen, politischen etc. Eliten eine übergeordnete Referenz und jeweils staatliche politische Stabilität verleihen. Es reicht allerdings ein Blick z.B. in die Strategie der EU-Kommission „Green Deal“ um sich der Aktualität und Brisanz dieser Scharade bewusst zu werden. Während der Pandemiebekämpfung wurde eine durch regeln gesteuerte Interaktion der Akteure auf Kosten der Freiheitsrechte „aus Not“, dennoch flächendeckend implementiert. Es ist möglich, dass der neu etablierte Expertendirigismus bzw. eine Menschenrechte nivellierende Regelsteuerung der Gesellschaft irgendwann auch die Grundlage eines neuen Gesellschaftervertrages prägt. Denn mit der stillen Kontrolle der freien Marktwirtschaft entfällt auch der Ordnungsrahmen eines sozial-liberalen Gemeinwesens. Generell deuten die Veränderungen auf eine schleichende Amerikanisierung der Sozialstaaten in Europa hin. Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Fortschritt, von dem Klaus Schwab und Thierry Malleret aber auch die neue deutsche Regierung sprechen, öffentlich zwar nicht thematisiert, aber doch nach der bekannten TIPP-Vorlage (Transatlantic Trade and Investment Partnership -TTIP) abläuft.
Die planenden Eliten der realsozialistischen Planwirtschaft waren nicht in der Lage eine dynamische Entwicklung von Technik und Technologie zu berücksichtigen. Das hat letztlich dazu geführt, dass sie Menschen statt Sachen als Ressource verwaltet haben. Folglich blieb die Freiheit auf der Strecke und der vielzitierte Wohlstand rückte in unendliche Ferne. Den systemtragenden Eliten blieb Schlussendlich nur die Zuflucht in die Ideologie übrig, die sowohl als Motivationshintergrund für das täglichen Tun diente, als auch zur einzigen Stütze gesellschaftlicher Stabilisierung (Normalisierung durch Ideologie) wurde. Das Narrativ aus der Politwerkstatt der Nomenklatura, dass der Sozialismus nicht funktionierte, weil er Elitenlastig war, fußt auf einer Tautologie. Denn er war, wie er war, weil er Nomenklaturalastig gewesen ist. Jede Prosa, die sich um die Unfehlbarkeit irgendeiner Elite dreht führt einen inneren Widerspruch. Eine Frage jedoch bleibt: Warum soll überhaupt Eliten geglaubt werden, die sich immer selbst bedienen, sich stets nach dem Wind wenden und immer eine Rechtfertigung bei ihrem Versagen parat haben?
Weder Marx, noch Engels haben behauptet, dass mit dem Übergang von Kommerz-Kapitalismus zum Sozialismus eine krisenfeste Zeit anbricht. Kein Plan kann so perfekt sein, dass er der Kontingenz standhalten könnte. Es gilt für jede Gesellschaft, dass keine so gut ist, dass sie nicht besser (oder schlechter) werden könnte. Dieses „besser“ ist in unseren modernen Gesellschaften davon Abhängig, wie sich Eliten zur Akkumulation von Reichtum und seiner Distribution verhalten, d.h. wie sie Gerechtigkeit verstehen und umsetzen.
Über Gerechtigkeit wurden ganze Bibliotheken von Bücher geschrieben, aber die umfassendste Analyse des Phänomens wurde von John Rawls geschrieben. Sein Buch, erschienen 1971 (John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/Main, 1979, 688 S.), hat alle nachfolgenden Beschäftigungen mit der Gerechtigkeit beeinflusst. Was bildet das Kernstück seiner Analyse?
John Rawls ging von der Idee aus, dass Menschen vernunftgeleitete Akteure sind, die sich über die sie interessierende Themen, wie Gerechtigkeit, verständigen können. Aus seinem korporatistischen Model heraus wird in der Folgezeit die Gerechtigkeit oft als Fairness rezipiert. Zwar kann Rawls Model-Analyse des Phänomens auf Gerechtigkeit als Fairness hindeuten, aber ihm selbst waren die Dimensionen der Systematik, Gleichzeitigkeit und des Vergleiches im Diskurs „was ist Gerechtigkeit?“ nicht Fremd. Darüber hinaus würde John Rawls sicherlich sehr schwer fallen die Sprachkontrolle d.i. Korrektur dessen wie und was gesprochen wird, als einen wesentlichen Beitrag zur Gerechtigkeit, bzw. als Weg zur Schaffung einer gerechteren Welt, zu akzeptieren. Vielleicht sind wir doch in Gelsominos Welt (Gianni Rodari, Gelsomino im Lande der Lügner, Leipzig, 2020, 160 S.) unterwegs?
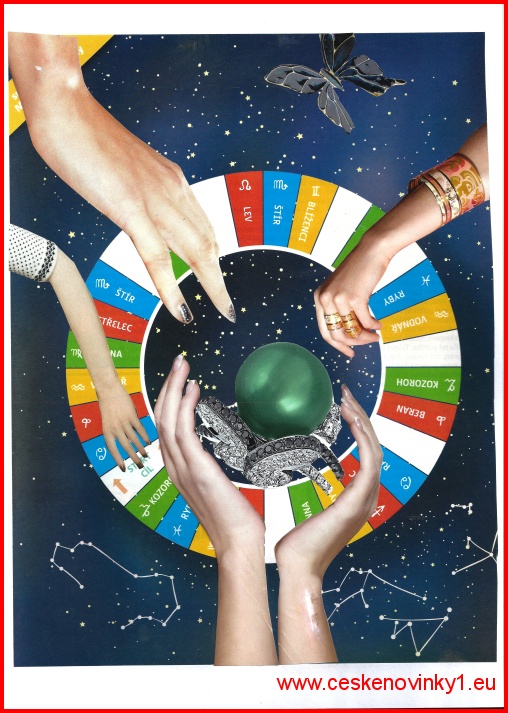
Wie über Gerechtigkeit gesprochen wird, ist für das Phänomen selbst nicht entscheidend. Ein Beispiel. In den letzten beiden Covid-Jahren (2020-21) hat sich die Zahl der Milliardäre um 537 Personen erhöht. An dieser Stelle kann eingestimmt werden, dass die Wirtschaft funktioniert, es wird Reichtum generiert und damit auch Wohlstand. Wenn die Perspektive wechselt dann wird evident, dass sich unsere Post-Covid-Miliardäre um 3 Wirtschaftsbereiche gruppieren: Pharmazeutik, Energie, Nahrungsmittel. Wenig überraschend auch aus dem Grunde, weil die staatlichen Schutzmaßnahmen, die Lenkung der Finanzströme und nicht zuletzt die Spekulationen aufgrund exklusiver Informationen alle Umverteilungen begünstigten. Es wird immer klarer, dass durch die Finanzwelt aufgestellte Regeln die Großen und Wichtigen um jeden Preis zu schützen, aber die Kleinen unbedeutenden Pleite gehen zu lassen (administrativ begleitete Zahlungsunfähigkeit) eben dieser Finanzbranche die permanente Chance bietet aus diesem Spiel das Maximum an Profit herauszuholen.
Die Post-Covid Politik klagt über Krisen. Vor allem wird die Logistik-Krise (sog. Lieferketten) als die Ursache vieler Verwerfungen thematisiert. In Wahrheit wird die Logistik seit Jahren auf engere Logistik-Wege umgebaut. Eine längst Fällige „Kontrolle der Regionalisierung“ geht mit Verlusten hier und Gewinnen dort einher. Die Aggressivität steigt. Was durch Geld, Gesetze und Überzeugungsarbeit nicht machbar scheint, wird durch rohe Gewalt umgesetzt. Auch der Konflikt mit der Russischen Föderation ist das Ergebnis der Konfrontation zwischen einen staatsmonopolistisch gelenkten System und der Globalisierung unter amerikanischen Dominanz und ihrer abendländischen Prägung. Eine Doppelstrategie soll zunächst die erhoffte Entmonopolisierung der russischen Wirtschaft in Richtung Wall Street bringen. Einerseits sollen russische Oligarchen enteignet und zugleich die russische Wirtschaft und Politik mit Sanktionen belegt werden. Bis Ende 2021 werden etwa 7.000 Sanktionen gegen Russland und Russen verhängt. Der steigende Druck zeugt von Eile. Eine eindeutige Antwort auf die Frage, was hinter dieser Eile steckt, fällt schwer. Gewaltige Krisensymptome werden bereits attestiert, aber auch das Erstarken von China, die Angst davor, dass die Volksrepublik zu einem frühere Zeitpunkt als gedacht wirtschaftliche und in Tandem mit Russland auch militärische Dominanz erlangen könnte, sind als Gründe denkbar.
Krisen sind Goldgruben für Spekulanten, Permanente Krisen sind Peitschen für das Volk. Über das Letztere sagt folgendes einiges aus: Während in den letzten beiden Jahren 2020-21 alle 30 Stunden das Licht der Welt ein Milliardär erblickte, dann sind alle 33 Stunden etwa 1 Million Menschen unter die Armutsgrenze gerutscht, in absoluten Zahlen cca. 260 Millionen Erdenbürger. Was durch Arbeit nicht zu erreichen ist wird gestohlen, ganz legal enteignet, rechtmäßig, durch Schutzmaßnahmen, Erpressung, Einfrieren von Konten, Korruption oder Sanktionen genommen. Hier sind Trends erkennbar: Nicht nur die Kluft zwischen Recht und Gerechtigkeit wird immer breiter, auch die Demontage des freien Marktwirtschaft hat ihren freien Lauf genommen.
Über Gerechtigkeit zu reden in einer Welt ohne Moral ist absurd. Aber wo entspringt Moral heute, nach zwei verheerenden Welt- und unzähligen Regionalkriegen? Eine Rückschau in die Geschichte des Denkens legt einige Reflexionen offen die eben um diese Frage kreisen. Aus einer Fülle von Autoren und Denkern kommt an dieser Stelle Emmanuel Levinas in den Sinn. Aus zweierlei Gründen. Erstens, er war ein Franzose aus Litauen, ein Outsider -insider abendländischer Kultur und Philosophie; Zweitens, er war ein Zeitzeuge von Kriegen, Holocaust und Revolution.
Levinas` Befund, dass der Gegensatz zu Moral nicht etwa Amoral ist, sonder der Krieg, mag simpel klingen, ist aber nicht trivial (Emmanuel Levinas, Totalität und Unendlichkeit. Ein Versuch über Exteriorität, Baden Baden, 2002, 470 S.). Seine Interpretation des Krieges (die Thematisierung Emmanuel Levinas Moralphilosophie an dieser Stelle würde das Thema sprengen; siehe dazu Enrique Dussel, Ethique de la libération. A l`ère de la mondialisation et de l`exclusion, Paris, 2002, 265p. p., 129-138) überschreitet dessen Horizont als puren militärischen Konfliktes, der aus der Perspektive etwa der Historie, der Politik oder der Psychologie auf plausible Weise beschrieben werden kann. Im Krieg, meint Levinas, wird ein System der Totalität implementiert dem sich der Einzelner nicht entziehen kann: Er wird eben zur Funktionseinheit und bekommt seinen Platz im Ganzen zugewiesen. Kriege sind auch latente Kriege in denen sich Egoismen bekämpfen. Letztere kommen oft ohne Blutvergießen aus, aber sie zeitigen gleiche Ergebnisse wie offene Kriege – Ursache dafür ist der sog. Kommerz (in Levinas Terminologie Kommerzium genannt). Darin wird der Tausch von „Werken“ (Oeuvres) realisiert. Das, was individuell erschaffen wurde, das Werk, wird in einem verschleierten, anonymen Tauschprozess zur Ware. An dieser Stelle findet nicht nur die Entfremdung statt, sondern darin tritt der Kommerz mit dem Krieg in direkte Verbindung. Die Realität des Krieges ist, dass der Wert des Einzelnen (Arbeiters, Produzenten etc.) in einer direkten Abhängigkeit zum Ganzen steht, bzw. von der Totalität des Marktes abgeleitet wird. Für Levinas ist demzufolge wesentlich ob ein gerechter Staat das Ergebnis von Kommerz ist, oder dieser als Resultat unteilbarer Verantwortung eines jeden Einzelnen für das Schicksal aller realisiert wird. Die Moral wäre demzufolge jenseits von Kommerz und Krieg zu verorten.
Im „große Umbruch“ von Klaus Schwab und Thierry Malleret ist Kommerz als Orientierungspunkt für globale Umgestaltung gesetzt. Somit ist der latente und ewige Krieg für die Zukunft festgeschrieben. Ist der Wall Street doch ein Fall für die Baker Street 221B? Dafür gibt es doch viele Anhaltspunkte.

